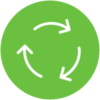T-Shirts oder Gartenmöbel aus alten Plastikflaschen? Was zunächst nachhaltig klingt, ist trügerisch. Wir erklären, warum Downcycling kein echtes Recycling ist. Mehr

Für die Einkäufe im Supermarkt bekommt man sie ebenso wie für den Biomüll: Tüten aus Bioplastik. Sie unterscheiden sich optisch kaum von einer normalen Plastiktüte, sollen ihr aber in Sachen Umweltverträglichkeit haushoch überlegen sein.

Dass konventioneller Kunststoff als unbedacht entsorgter Plastikmüll ernste Umweltprobleme verursacht, bestreitet heute niemand mehr. Plastikmüll verunreinigt Meere und Landschaften, während bei der Herstellung von neuen Kunststoffverpackungen aus Erdöl so viel Kohlendioxid entsteht, dass es bis 2050 für 15 Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich sein wird.
Um das zu verhindern, entdecken Händler und Hersteller das Bioplastik für sich. Seit Sommer 2019 stellen etwa Aldi Süd und Aldi Nord die Knotenbeutel für Frischobst aus nachwachsenden Rohstoffen her.
Auch der dänische Spielzeuggigant Lego, der pro Minute acht Millionen Plastikklötze herstellt, will bis 2030 seine komplette Produktion auf Bioplastik umgestellt haben. Hunderte Forscherinnen und Forscher sollen in den kommenden Jahren das Bio-Lego der Zukunft entwickeln.
Plastik wird also bio. Ist das Problem damit gelöst?
Nein, denn der Begriff Bioplastik suggeriert eine Umweltverträglichkeit, die in Wahrheit nicht gegeben ist. Im Gegenteil, viele Artikel aus Bioplastik können der Umwelt sogar schaden. Und nicht nur das – auch uns könnten sie möglicherweise gefährlich werden. 2020 untersuchte eine internationale Forschungsgruppe die chemischen Eigenschaften von Alltagsgegenständen aus Bioplastik, darunter Einweggeschirr, Trinkflaschen und Schokoladenpapier. Ergebnis: Rund 80 Prozent der untersuchten Produkte enthielten mindestens eine toxische Chemikalie.
In ihrem chemischen Aufbau unterscheiden sie sich nicht von gewöhnlichem Plastik. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ihre Polymere nicht aus fossilen, sondern aus erneuerbaren Quellen stammen. Die Plastiksorten PE (Polyethylen) und PET (Polyethylenterephthalat) lassen sich zum Beispiel aus Zuckerrohr herstellen.
Ihre nachwachsenden Rohstoffe machen die biobasierten Kunststoffe klimaneutral, zumindest theoretisch: Für ihr Wachstum benötigen die Pflanzen Kohlendioxid, das sie der Luft entnehmen. Während erdölbasiertes Plastik bei seiner Verbrennung oder Verrottung CO2 in die Atmosphäre freisetzt, das Millionen Jahre unter der Erde gelagert war, haben Rohstoffe für Bioplastik ihr freigesetztes CO2 erst vor kurzem gebunden. Da sie schnell nachwachsen, nehmen die Pflanzen das entstehende CO2 schon nach kurzer Zeit wieder auf.

Das klingt hervorragend, ist aber zu kurzsichtig. Für Monokulturen von Mais oder Zuckerrohr werden riesige Waldareale gerodet und zu Ackerland umgewandelt. Für die Klimabilanz ist das verheerend, denn Wälder binden viel mehr Kohlendioxid als Mais oder Zuckerrohr. Außerdem setzt die industrielle Landwirtschaft mineralische Dünger und chemische Pestizide ein, die klimaschädlich produziert wurden. Sie ruinieren die Boden-, Wasser- und Luftqualität der Anbaufläche und vernichten zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.
Das Bundesumweltamt kommt in einer Studie deshalb zu dem Schluss, dass Verpackungen aus Bioplastik in der Ökobilanz keinerlei Vorteile gegenüber Verpackungen aus konventionellem Plastik bieten.
Biobasiertes Plastik kommt zudem häufig als Mogelpackung daher, denn oft stammt sein Material nur zum überwiegenden Teil aus nachwachsenden Quellen. Den Produkten wird konventionelles Plastik beigemischt, um die gewünschten Materialeigenschaften zu erhalten. Wahrheitsgehalt und ökologische Aussagekraft der Bezeichnung „biobasiert“ seien daher begrenzt, meint das Umweltbundesamt.
Bei der zweiten Sorte Bioplastik handelt es sich um vermeintlich kompostierbaren Kunststoff. Er besteht aus Material, das nach seiner Nutzung durch Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze vollständig in Wasser und Kohlendioxid zerlegt wird.
Das funktioniert allerdings nur unter Bedingungen, wie sie in einer industriellen Kompostieranlage herrschen, wo das Material hohen Temperaturen und extremer Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Auf dem eigenen Gartenkompost oder in der freien Natur zersetzt sich das Material kaum schneller als normales Plastik.
In einem Gutachten aus dem Jahr 2018 hat das Bundesumweltamt Forschungsarbeiten ausgewertet, die sich mit der Abbaubarkeit von Bioplastik befassen. Die Autoren gehen der Frage nach, wie gut sich Bioplastik im Erdboden, in Salzwasser und in Süßwasser abbaut. Sie kommen zu dem Schluss, dass auch biologisch abbaubares Plastik Monate bis Jahre in der Umwelt erhalten bleibt.
Ähnliche Ergebnisse lieferte eine Studie der britischen University of Plymouth aus dem Jahr 2019. Die Forscher setzten kompostierbare Plastikbeutel verschiedenen Umwelteinflüssen aus. Nach drei Jahren im Boden oder in Salzwasser waren die Tüten noch stabil genug sein, um ein Füllgewicht von zwei Kilo zu tragen.
Selbst wenn abbaubare Verpackungen über die Grüne Tonne in einer Kompostieranlage landen, werden sie dort in der Regel als Störstoffe aussortiert und verbrannt. Denn auch unter optimalen Bedingungen benötigt die Zersetzung des Materials Wochen und Monate, länger, als in den meisten Anlagen kompostiert wird. Erschwerend kommt hinzu, dass Verbraucher häufig nicht zwischen abbaubarem und konventionellem Plastik unterscheiden können. Immer häufiger klagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kompostieranlagen darüber, dass sich seit Aufkommen der Biotüten wieder vermehrt normale Plastikbeutel im Biomüll finden.
Auch wenn kompostierbarer Kunststoff komplett zerfällt, gibt es noch Probleme. Viele Produkte enthalten Anteile von normalem Plastik, die nach der Zersetzung als Mikroplastik zurückbleiben. Jedes Jahr gelangen so rund 900 Mikropartikel pro Kilo Kompost auf unsere Felder.
Der abbaubare Teil verrottet zwar tatsächlich, bringt der Natur aber keinen Vorteil. Das Bioplastik spaltet sich lediglich in Wasser und Kohlendioxid und führt dem Boden keinerlei Nährstoffe zu. Das Umweltbundesamt kommt deshalb zum Schluss, dass Verbrennen der ökobilanziell sinnvollste Umgang mit kompostierbaren Kunststofftüten ist.
Könnte man abbaubares Plastik nicht einfach mit dem anderen Verpackungsmüll recyceln? Nein, denn es lässt sich nicht so verarbeiten wie Verpackungen aus herkömmlichen Kunststoffen, etwa Polyethylen.
Wegen ihrer spezifischen Materialeigenschaften lassen sich viele kompostierbare Kunststoffe nicht mit den üblichen Methoden wiederverwerten. Zum Beispiel halten sie den etablierten Waschschritten in einer Recyclinganlage nicht stand und verklumpen zu einer zähen Masse, die das Recycling der nutzbaren Kunststoffe erschwert.
Forscher vom Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik der Universität Bonn haben 2018 die Auswirkungen der Produktion von Bioplastik auf die Umwelt untersucht und verschiedene Szenarien durchgespielt. Sie kommen zum Fazit, dass der vermehrte Einsatz von Bioplastik das Klima schädigen könnte, zugleich aber das Plastikmüllproblem nicht lösen wird. Zum Schutz der Umwelt empfehlen sie stattdessen einen sparsamen Umgang mit Plastik und ein möglichst vollständiges Recycling.
In einer Folgestudie aus dem Jahr 2021 stellte dasselbe Forscherteam fest, dass die Situation sogar noch schlimmer ist als gedacht: Demnach sind die CO2-Fußabdrücke kommerzieller Biokunststoffe deutlich größer als die Werte, die bislang in der wissenschaftlichen Literatur und in politischen Berichten geschätzt wurden.
Statt dem Trend mit dem Bioplastik zu folgen, setzt unser Gründungsunternehmen Werner & Mertz schon seit Jahren auf hochwertiges Recycling im geschlossenen Wertstoffkreislauf. Indem Plastik in einem stetigen Kreislauf gehalten und immer wieder neu verwendet wird, muss kein neues Plastik aus Erdöl hergestellt werden. Das minimiert die CO2-Bilanz jedes einzelnen Plastikproduktes und hält zugleich Plastik aus der Umwelt fern.

Dank hochmoderner Sortier- und Verarbeitungsverfahren stammen heutzutage bei allen PET-Flaschen der Marke Frosch ganze 50 Prozent des verwendeten Materials aus dem Gelben Sack. Selbst die Klappdeckelverschlüsse der Froschreiniger-Flaschen kommen aus dem Gelben Sack: Sie bestehen zu hundert Prozent aus recyceltem PP.
Die Flaschen der emsal Bodenpflege, der Green Care Professional Reiniger und die Duschgelflaschen von Frosch können sogar komplett mit recyceltem HDPE-Abfall aus dem Gelben Sack hergestellt werden.
Werner & Mertz optimiert den Einsatz von mechanisch recyceltem Kunststoff permanent und produziert Flaschen aus 100 Prozent Post-Consumer-Rezyklat. Seit Mitte 2023 stammen zwischen 75 und 100 Prozent davon aus dem Gelben Sack.
Bewusst einkaufen:
Wo Bio draufsteht, ist nicht immer Bio drin. Für Bioplastik gilt das ganz besonders. Alle marktgängigen Varianten sind kaum mehr als Vermarktungstricks, mit denen Verbraucherinnen und Verbrauchern Nachhaltigkeit vorgegaukelt werden soll. Dabei sind die Ökobilanzen der verschiedenen Bioplastik-Varianten extrem problematisch, einen positiven Effekt für die Umwelt konnten Studien bisher nicht verzeichnen. Aufgeklärte Kundinnen und Kunden sollten auf die Bio-Behauptung nicht hereinfallen.
Richtig entsorgen:
Vermeintlich kompostierbare Verpackungen lassen sich nicht zusammen mit gewöhnlichen Kunststoffen recyceln. Sie stören die Abläufe in der Recyclinganlage und führen dazu, dass anderes, recyclingfähiges Plastik unbrauchbar wird. Deshalb sollte man Verpackungen aus abbaubarem Kunststoff nicht im Gelben Sack entsorgen. Da sie auch in der Kompostieranlage stören, gehören sie auch nicht in die Grüne Tonne. So absurd es klingt: Die nachhaltigste Option ist, kompostierbaren Kunststoff gemeinsam mit dem Restmüll zu verbrennen. Biomüll sammelt man am besten in Papiertüten und entsorgt ihn ohne Tüte in der Grünen Tonne oder auf den Kompost.